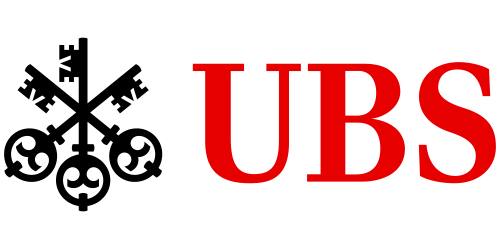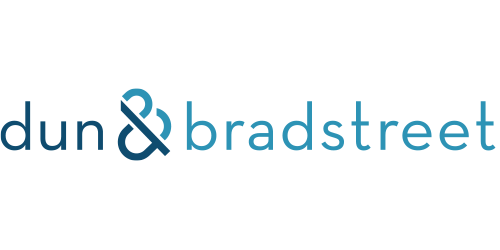Wie China mit der Welt verhandelt
China hat es im Rahmen der eigenen und globalen wirtschaftlichen Dynamik der letzten 40 Jahre geschafft, sich auf der Welt politisch und ökonomisch clever zu positionieren.
Ein Rezept für diesen Erfolg entstammt dem strategischen Konzept des Konstellationsdesigns (Zaoshi). Dieses entspringt der Yin-Yang-Philosophie und den chinesischen Strategemen. Im Gegensatz zum westlichen Verhandlungs- und Strategiedenken konzentriert sich dieser Ansatz nicht darauf, das Verhandlungsspiel möglichst gut zu spielen, sondern die Verhandlungen selbst und die Regeln so zu gestalten, dass eine möglichst optimale Lösung resultiert, und zwar mehr oder weniger unabhängig davon, wie der Gegenspieler sich verhält.
Sinnbildlich steht das Schachspiel im kulturellen Westen für die höchste Form des Strategiedenkens. Wir spielen nach Regeln und hinterfragen die Regeln und ihre Entstehung nicht. Das chinesische Zaoshi ist ambitionierter und vielversprechender, weil hier das Spielfeld und die Regeln gestaltet werden. Diese Strategie ist kreativer und mehrdimensional, weshalb sie besonders gut auf das aktuell vielschichtige geo- und wirtschaftspolitische Umfeld anwendbar ist. Das Konzept VUCA-Welt versucht das auszudrücken. Das wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Umfeld wird immer schnelllebiger (Volatility), unsicherer (Uncertainty), komplexer (Complexity) und mehrdeutiger (Ambiguity). In einer solchen Welt funktionieren monokausale und rationalistische Strategien und Verhandlungen nicht mehr. Hier kommen Konstellationsdesigns zum Zuge, das heisst ein aktives Einwirken auf das Umfeld, die Begebenheiten und die Rahmenbedingungen. Es ist das, was wir dann im Westen als Raffinesse und Cleverness wahrnehmen; im chinesischen Kontext ist es aber Teil der Strategie.
China bringt das in seinen weltpolitischen Ambitionen immer wieder zum Ausdruck. Peking schafft das zum Beispiel mit dem etwas undurchsichtigen BRICS-Konstrukt. Über die Unbekannte BRICS wird medial viel berichtet, und sie wird als die neue globale Stimme des Südens wahrgenommen. Fakt ist, dass das BRICS-Konstrukt keine internationale Organisation ist. Die BRICS-Staaten verfügen weder über ein ständiges Sekretariat noch haben sie eine Charta. Dennoch hat dieses Konglomerat eine hohe Anziehungskraft und wird mehr und mehr zum Symbol und Ort einer neuen weltpolitischen Multipolarität. Freund-, Feind- und Mitbewerberlogiken verschwimmen zusehends. Das langfristige angelegte und gemeinsame Ziel – eine Alternative zum Norden zu sein – hält die Länder zusammen. Gleichzeitig werden mit Fakten wie Infrastrukturen und Technologievorherrschaft Abhängigkeiten geschaffen. Diese Länder rücken mit sehr feingliedrigen Verflechtungen mehr und mehr zusammen, immer mit verschiedenen Optionen, wie es weitergehen könnte. In solchen Konstellationen müssen nicht alle stets gleicher Meinung sein, sondern es können gewisse Staaten situativ gemeinsam unterwegs sein und in anderen Dossiers auch wieder nicht. Damit können sie agil navigieren und auf unvorhersehbare Ereignisse und Wendungen eingehen, ohne das strategische Ziel aus den Augen zu verlieren.
Deshalb ist es aktuell China gelungen, bisher relativ unbeschadet die Präsidentschaft Trump zu handhaben. Sie waren darauf vorbereitet und können situativ alle Register der geopolitischen, infrastrukturellen und ökonomischen Machtprojektion nutzen. Der globale Süden findet in China einen offenen, wohlgesonnenen und verlässlichen Partner, während die USA als dominant und wechselhaft wahrgenommen werden. Dieser Wettbewerb ist somit auch ein Krieg der Narrative. Die Narrative sind jedoch mit Fakten wie Infrastrukturen, Investitionen und entsprechenden Abhängigkeiten hinterlegt. In diesem Denken gilt nicht der taktische Sieg, sondern das strategische Ziel. Rückschläge werden als neue Chance gesehen, im Zweifelsfall sogar uminterpretiert und in neuem Kontext dargestellt. Es ist also auch ein Plädoyer gegen die Alternativlosigkeit und erinnert in diesem Punkt sehr an unsere Start-up- und Innovationsszene.
Die Kunst des Verhandelns liegt folglich nicht im Verhandeln selbst, sondern im Gestalten des Rahmens. Während westliches Denken sehr linear ist, umkreist das chinesische Denken ein Problem. Konventionelle und unkonventionelle Methoden werden gleichsam verwendet. Dieses Agieren ist gleichzeitig aktiv und zuwartend. Das verlangt nach Kreativität, Akribie, Umsicht und Sorgfalt. Es ist kommunikativ und operativ zugleich. Gelassenheit und Besonnenheit sind in diesem Verhalten der Gegenpol zur westlichen Hektik und Aufgeregtheit.
Diese Verhandlungsstrategie der Konstellationen ist zudem sehr interdisziplinär angelegt. Die Chinesen spielen möglichst auf der gesamten Klaviatur der Weltpolitik. Militär, Diplomatie, Infrastrukturen und Wirtschaft sind dabei nur Vektoren unter vielen. Dazu kommen Elemente wie Kultur, Umwelt, Medien und Recht, die ebenfalls zum Machtprojekt eingesetzt werden können. Es ist ein Denken in Optionen. Handlungsfreiheit ist somit eine Mentalität. Das Stichwort heisst Resilienz.Resilienz als strategisches Momentum mitzudenken und vor allem mittel- bis langfristige Resilienzarchitekturen in Staat und Unternehmen aufzubauen, bei denen man «en passant» und nahezu unbemerkt die Spielregeln definiert, sind die neuen Vektoren internationaler Verhandlungspolitik.